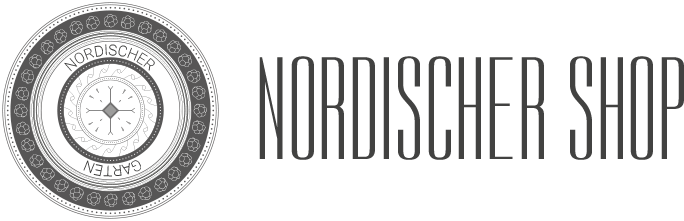Deutscher Name: Rotkehlchen
Lateinisch: Erithacus rubecula
Familie: Fliegenschnäpper
Körpergröße: ca. 14 cm
Flügelspannweite: ca. 20 – 22 cm cm
Lebensdauer: durchschnittlich nicht einmal 1,5 Jahren (unter Berücksichtigung der geringen Überlebensrate der Nestlinge). Vögel, die das erste Jahr erreichen, schaffen meist ein Alter von drei bis vier Jahren.
Navigation:
Merkmale
Lebensraum & Vorkommen
Nahrung
Füttern
Nest
Brutpflege
Leben und Verhalten
Das Rotkehlchen gilt im Moment als nicht gefährdet. Es ist Deutschlands etwa sechsthäufigste Vogelart. Das niedliches Aussehen und seine Zutraulichkeit machen es äußerst beliebt. Sein niedliches Aussehen (Kindchenschema) spricht unseren Beschützerinstinkt an. Ein hochintelligenter Vogel mit einem ungeheurem Verhaltensrepertoire
Merkmale des Rotkehlchens:
Rundliche, pummelige Gestalt. Orangerote Kehle, Stirn und Vorderbrust machen es unverkennbar. Jungvögel haben noch keine rote Kehle! Beim Rotkehlchen gibt es keinen Geschlechtsdimorphismus, Männchen und Weibchen sehen gleich aus.
Lebensraum
Eigentlich ein typischer Wald, Waldrand- und Buschvogel, der auch die Nähe von Wasser schätzt. Das Rotkehlchen zieht schattige und feuchtere Gebiete trockenen und heißen Arealen vor. Im Gebirge ist es bis in 2600 m Höhe zu finden. Daher zählen reichhaltige Kulturlandschaften mit Streuobstwiesen, Gärten, Parks, Friedhöfen und Gehölzstreifen ebenfalls zu seinen bevorzugten Lebensräumen.
Vorkommen: Mitteleuropa, Nordafrika, Kleinasien, Mittelmeerinseln. Fehlt in Island, in Nord- und Osteuropa nur Sommervogel der im Winter in südlichere Regionen zieht
Nahrung der Rotkehlchen
Als vielseitiger Allesfresser ernährt es sich hauptsächlich von Insekten, kleinen Spinnen und Regenwürmern. Ergänzend werden Früchte und weiche Samen aufgenommen.
Im Spätsommer, Herbst und Winter wird sie durch pflanzliche Nahrung ergänzt.
Während der Zugzeit geht der Anteil pflanzlicher Nahrung jedoch stark zurück
Zur Nahrungssuche bewegt sich das Rotkehlchen hüpfend und flatternd in meist kleinen Sprüngen auf der Erde vorwärts, selten werden kurze Schritte gemacht. Durch Umdrehen und Ablesen des Laubes, seltener von Stämmen oder Ästen, oder durch die Ansitzjagd mit anschließendem Hinunterstoßen kann es Insekten erreichen. Teilweise werden diese sogar im Flug erbeutet! Das Rotkehlchen ergreift auch gern die Beute, wenn Nahrungstiere von anderen Tieren freigelegt oder aufgescheucht werden oder andere Vögel sie von Bäumen herunterfallen lassen. Kleine Steine werden zur Verdauungsförderung aufgenommen, unverdauliche Teile wie Chitin als Gewölle in länglichen Ballen hervorgewürgt.
Es wurden schon Rotkehlchen beobachtet, die im seichten Wasser erfolgreich Wasserinsekten wie Libellenlarven oder Köcherfliegen und selbst kleine Fische fangen.
Während der Brutzeit ist die Nahrung fast ausnahmslos aus tierischen Bestandteilen zusammengesetzt. Daher ist für die ausreichende Versorgung der Jungvögel eine hoher Insekten- und Kleintierbestand von allerhöchster Bedeutung. Dieser Bestand an Insekten kann durch wilde Ecken, wilde Bereiche, heimische Blühpflanzen, kleine Blumenwiesen, Obstgehölze und Gemüsegärten, Wasserstellen sowie liegenbleibendes Laub und andere mannigfaltige Strukturen im Garten gefördert und enorm erhöht werden.
Dass keinerlei Gifte im Garten zur Anwendung kommen, ist ein Gebot der Stunde!
Bei Rotkehlchen beliebte heimische Wildgehölze mit Beeren:
- Pfaffenkäppchen oder Rotkehlchenbrot (Euonymus europaeus)
- Mehlbeere (Sorbus aria)
- Schwedische Mehlbeere (Sorbus x intermedia)
- Liguster (Ligustrum vulgare)
- Seidelbast (Daphne mezereum)
Dabei behalten etwa 80 Prozent der wieder ausgeschiedenen Beerensamen ihre Keimfähigkeit! So tragen unsere Gartenvögel ideal zur natürlichen Verbreitung vieler heimischer Wildgehölze bei.
Fütterung:
Häufig und gerne am Futterhäuschen, wo es Fettfutter (Haferflocken in Öl getränkt) und Weichfutter (Rosinen) vorzieht. Auch kleine Sämereien oder feiner Nussbruch wird gelegentlich aufgenommen.
Weil Rotkehlchen auch im Winter ihre Reviere mit Vehemenz gegen Artgenossen verteidigen, sind sie am Futterhäuschen stets alleine anzutreffen. Hingegen stören sie andere Vogelarten wie Blau- oder Sumpfmeisen keinesfalls. Es wechseln sich allerdings durchaus mehrere Rotkehlchenindividuen aus der nahen Umgebung ab! Dies konnte durch Beringung nachgewiesen werden.
Rotkehlchen können speziell in der Brutzeit hervorragend mit Mehlwürmern und anderen Insektenlarven, am besten lebend, unterstützt werden.
Nest
Der gegen Regen geschützte Nistplatz wird vom Weibchen bestimmt, das in den ersten beiden Tagen am intensivsten daran baut. Das offene, napfförmige Nest befindet sich meistens in Bodenvertiefungen, in Halbhöhlen, im Wurzelgeflecht am Boden, unter Gestrüpp oder in hohlen Baumstümpfen.
Bei einer Untersuchungen befanden sich fast 75 Prozent der Bodennester in Böschungen, ca. 20 Prozent auf ebener Erde und etwa 5 Prozent in Dosen und Töpfen.
Zum Nestbau werden vor allem trockenes Laub und Moss, Stängel, Halme und feine Wurzeln genutzt. Ausgepolstert wird das Nest mit Tierhaaren, Pflanzenwolle und Federn. Es hat einen Durchmesser von etwa 13 cm und eine Höhe von etwa 4,5 cm; bei einer Tiefe von etwa drei Zentimetern beträgt der Durchmesser der Nestmulde etwa fünf Zentimeter.
Die Nestbaudauer beträgt vier bis fünf Tage. Während dieser Zeit singt das Männchen von einer hohen Singwarte, die sich über dem Weibchen befindet. Das Rotkehlchen verwendet für seine zweite Brut nicht noch einmal dasselbe Nest.
Oft verwendet das Rotkehlchen auch alte Nester etwa von Amseln aber auch anderen Vögeln. Auch Nischenbrüterkästen, die nicht allzu hoch hängen und erschütterungsfrei sind, nimmt es an. Zudem werden an Schuttplätzen und auf Müllkippen Nester in Dosen, Töpfen, Eimern, Gießkannen oder Schuhen gebaut.
Rotkehlchen: Balz und Brut
Die Weibchen gründen im Herbst eigene Reviere und verteidigen diese mit ihrem Gesang auch gegen Männchen.
Die Balz bzw. die Annäherung gestaltet sich anfangs etwas schwierig, weil Männchen und Weibchen gleich aussehen. Das Weibchen macht dem Männchen durch verschiedene Verhaltensweise über einige Tage deutlich, dass es ein Weibchen und kein Eindringling ist.
Das Rotkehlchen ist schon im ersten Lebensjahr paarungsbereit. Es führt über die Dauer der Brut eine monogame Brutehe.
Der Legebeginn fällt in Mitteleuropa meistens in den April. Zwei Jahresbruten sind die Regel, Drittbruten eine seltene Ausnahme. Meist werden sechs Eier gelegt.
Während der Legeperiode wird das Gelege vom allein brütenden Weibchen mit Laub getarnt. Während der 13 bis 15 Tage langen Brutdauer sitzt es sehr fest und ausdauernd auf dem Nest. In den Brutpausen von normalerweise drei bis fünf Minuten Länge wird es vom Männchen außerhalb des Nestes gefüttert, um den Standort des Geleges zu verbergen. Wird das Weibchen vom Nest verjagt, fliegt es sofort weg. In wenigen Fällen konnte Verleiten beobachtet werden. Ein sich nähernder Kuckuck wird heftig bekämpft.
Für den Bruterfolg des Rotkehlchens ist nicht die Größe des Reviers entscheidend, sondern ein strukturreicher Garten und die Beschaffenheit des Bodenbewuchses. Der Bruterfolg liegt bei den Bodennestern des Rotkehlchens bei Werten um knappe 30 Prozent. Gelege und Jungvögel werden mannigfaltig durch den Kuckuck, Eichelhäher, Elster, Mäuse, Ratten, Wiesel, Igel, Dachs, Fuchs sowie Waldkautz und Bussard bedroht.
Vom ökologischen Standpunkt sind also Eier wie auch Jungvögel wiederum selbst für viele Tierarten überlebenswichtige Mahlzeiten.
Ab 18. bis 22. Tag nehmen die Jungen selbständig Futter auf. Sobald sie vollkommen selbständig sind, werden sie aus dem Brutrevier der Altvögel vertrieben.
Auch bei der Jungenaufzucht spielen Rufe eine wichtige Rolle. Da die Nestlinge sich bei Erschütterungen des Nestes nicht rühren, löst erst ein leise schnatternder Fütterruf des Altvogels das Aufsperren der Schnäbel aus. Ab dem siebten Tag geben die Jungvögel zwitschernde Bettellaute von sich. Flügge Junge betteln mit einem lauten „Zit“.
Leben und Verhalten
Das Rotkehlchen folgt gerne Großsäugetieren wie Wildschweinen im Wald, um aus dem aufgewühlten Erdreich Insekten und andere Tiere aufzulesen. Insofern zählt auch der Mensch zu diesen Großsäugetieren, denn bei der Gartenarbeit wird Boden aufgewühlt, was dem Rotkehlchen zu einfacher Beute verhilft. Rasch ist es zur Stelle um nach kleinen Insekten, Spinnen und dgl. zu suchen. Großsäuger und Menschen werden aktiv aufsucht, weil sich oft Insekten bzw. Beutetiere in deren Nähe befinden. Altvögel führen bereits ihre Jungen an große Tiere heran und geben so Wissen weiter.
Das Rotkehlchen ist normalerweise tag- und dämmerungsaktiv, teilweise aber auch nachtaktiv. So kann es nachts im Mondlicht oder in der Nähe künstlicher Lichtquellen auf Insektenjagd gehen.
Seine Aktivität setzt etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang ein und endet meist eine Stunde nach Sonnenuntergang. Das Rotkehlchen übernachtet im Regelfall einzeln, gewöhnlich versteckt in dichtem Gebüsch; in strengen Wintern sucht es jedoch auch Gartenhütten, Hühnerställe, Taubenschläge und ähnliches auf.
Für uns Menschen schauen sie ja sehr lieb aus, aber Rotkehlchen sind sehr streitbare und untereinander durchaus aggressive Einzelkämpfer. Die rote Brust ist übrigens eine weithin sichtbare Warnung für Artgenossen. Sie signalisiert: Hier bin ich! Es ist besser, du bleibst mir fern.
Garten – wie sollen er beschaffen sein?
Das Rotkehlchen meidet vegetationslose Flächen nach Möglichkeit. Es fliegt daher oft dicht über dem Boden von irgendeinem Versteck direkt dem nächsten entgegen. Gärten mit einem guten Maß an bodennahen Versteckmöglichkeiten und wilden Ecken oder Bereichen werden gerne angenommen.
Bedornte, stechende und dichte Gehölze, wie Berberitzen, Zitronenquitten oder Weißdorne schützen überdies perfekt vor Zugriffen von Katzen oder anderen jagenden Tieren. Diese Sicherheit dieser Gehölze erleichtert es Rotkehlchen sehr, im Garten aktive auf Jagd nach Insekten zu gehen oder auch an geeignete Futterstellen heranzufliegen.
Rotkehlchen Zugverhalten
Die Rotkehlchen-Populationen im Norden und im Osten Europas sind Zugvögel, die im Oktober fortziehen und im März zurückkehren.
Die Populationen der milderen Verbreitungsgebiete sind eher Standvögel, überwintern also ohne zu ziehen (z.B. Britischen Inseln, Mittelmeerraum, Naher Osten).
Dazwischen gibt es Übergangsformen wie Kurzstreckenzieher oder Teilzieher.
Wir wissen also nie, woher die Rotkehlchen stammen, die sich gerade in unseren Gärten aufhalten.
Baden
Zu allen Jahreszeiten badet das Rotkehlchen sehr gerne. Morgens wäscht es das Gefieder flügelschlagend an tau- oder regennassen Blättern, um sich anschließend kräftig zu schütteln und zu putzen.
Dabei bedient es sich auch der Technik des Einemsens, indem es einzelne Ameisen mit dem Schnabel aufliest und durch das Gefieder zieht. Man vermutet, dass die abgegebene Ameisensäure einen schützenden und pflegenden Effekt für das Gefieder hat.
Beim Sonnen kauert es mit geöffnetem Schnabel, meistens auf dem Boden, aber auch auf Ästen liegend. Abends zieht es das Bad an flachen Uferstellen oder an Tränken vor. Im Winter badet das Rotkehlchen notfalls auf dem Eis.
Stimme & Gesang
Sehr eifriger Sänger, fast das ganze Jahr zu hören, am intensivsten in der Brutzeit. Bereits lange vor Tagesanbruch bis in die späte Abenddämmerung nach der Amsel.
Der Gesang des Rotkehlchens ist mit 275 nachgewiesenen, sich fortlaufend ändernden Motiven äußerst variabel. Er wird mit vorgestreckter, das Rot betonender Brust, in der Regel von einer hohen Singwarte aus, vorgetragen. Er beginnt etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang und ist noch eine gute Zeit nach Sonnenuntergang zu hören, hauptsächlich jedoch während der Dämmerung. Rotkehlchen singen mit Ausnahme der Mauserzeit das ganze Jahr über.
Das Rotkehlchen fällt auch durch seinen Alarm- und Störungsruf auf, Es handelt sich um eine Reihe von kräftigen, schnell wiederholten „Zik“-Elementen.
Wissenswertes:
Rotkehlchen spielen bei der Entdeckung und wissenschaftlichen Anerkennung des Magnetsinns von Tieren eine wichtige Rolle.
Buchtipps:
Das große Buch der Gartenvögel, Uwe Westphal
Vögel füttern, aber richtig, Berthold, Mohr
Vögel, Sonja Kübler