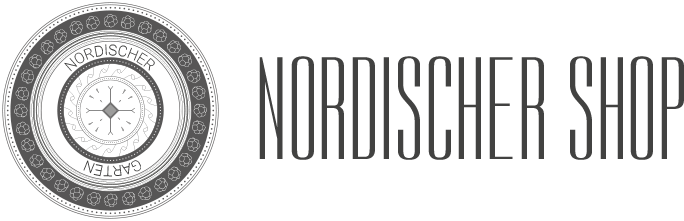Deutscher Name: Asch-Weide, Aschweide
Synonyme: Grau-Weide, Grauweide
Botanisch: Salix cinerea
Familie: Weidengewächse (Salicaceae)
Der Name Asch- oder Grau-Weide kommt von der grauen Farbe der Rinde sowie der aschgrauen Blattunterseite, die besonders im Frühjahr besonders auffallend ist, wenn das Laub noch nicht vollständig entfaltet ist.
Höhe / Breite: ca. 2 – 5 m hoch sowie breit – selten höher
Wuchs: vom Boden weg meist mehrstämmig und sich mehr oder weniger dicht verzweigend, halbkugelig wachsend, Jahreszuwachs ca. 40 – 50 cm
Eigenschaften: extrem robust, sehr frosthart, windresistent, hohes Ausschlagsvermögen, verträgt auch heftige Rückschnitte, schwachen Schatten sowie auch längere Überschwemmungszeiten
Blütezeit: März–April
Blüte: gelbe, eiförmige Kätzchen vor dem Laubaustrieb
Blatt: elliptisch, unterseits aschgrau und samtartig
Herbstfarbe: Gelbtöne
Wurzel: flach ausgebreitet und dicht verzweigt
Verwendung im Garten: Wichtige, frühblühende Bienenweide und Schmetterlingspflanze. Guter Bodenfestiger – etwa für Böschungsbepflanzungen wie steile Bachufer. Ideal auch für nasse Stellen, z.B. Ufer-Bereiche eines Gartenteiches. Die Aschweide nimmt in ihrer natürlichen breitbuschigen Wuchsform relativ viel Fläche ein, könnte aber bedarfsweise gut geschnitten werden. Im Vergleich mit vielen anderen heimischen Weiden bleibt sie dennoch deutlich kleiner.
Standort: sonnig bis absonnig
Boden: anspruchslos – auf allen frischen bis feuchten, auch nassen sowie auch nährstoffarmen Böden, jedoch eher kalkmeidend
Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa vom Westen Frankreichs bis nach Kleinasien, Südskandinavien und weit nach Russland hinein verbreitet. Häufig auf Moorwiesen und an den Rändern von Mooren, Sümpfen, Tümpeln, Gräben und Bächen. Vom Tiefland bis in den Alpen in einer Höhe von bis zu 1500 Metern.
Wichtiger früher Futterlieferant für Wildbienen, Hummeln, natürlich auch Honigbienen. Der Pollen wird von über 30 Wildbienen-Arten (10 davon sogar spezialisiert auf die Gruppe der Weiden) gesammelt.
Wie alle heimischen Weiden ist auch die Aschweide als Raupenfutterpflanze unglaublich! Fast 140 (!!!) Raupenarten, davon etwa 25 spezialisiert wurden bereits auf der Aschweide nachgewiesen. Besonders Nachtfalter, aber auch etliche bekannte und teils sehr seltene Tagfalter.
Großer Schillerfalter, Kleiner Schillerfalter, Großer Fuchs, Trauermantel, Tag- und Nachtpfauenauge um einige zu nennen. Dazu kommen knappe 20 Schmetterlinge, die am Nektar der frühen Kätzchen saugen.
Als „kleine“ Draufgabe sind weiters bereits 20 Schwebfliegen und über 30 Käferarten an dieser Weide nachgewiesen worden – diese sammeln hauptsächlich Nektar und Pollen.
Schau dir dazu gerne unseren Beitrag zur Suche nach Schmetterlingen im Winter an. Wir konnten die Raupe eines Großen Schillerfalters an einer Salweide entdecken. Dies wäre auch an der Grauweide denkbar. Der Link ist unten angefügt.
Die Zweige kann man sehr gut zum Korbflechten oder auch für „Weiden-Zäune“ verwenden. Die tanninhaltige Rinde wurde zum Gerben von Leder verwendet. Die Rinde kann aufgrund der enthaltenen Salicylsäure auch als Heilmittel gegen (Kopf-)Schmerzen, Fieber und Entzündungen verwendet werden. Daneben sind Weiden vorzügliche, milde Speisebäume.
Schau dir dazu gerne unseren Beitrag über die Verwendung von Weiden in Ernährung und Volksmedizin an. Der Link ist angefügt.
Muss nicht regelmäßig geschnitten werden, jedoch fördert der jährliche Rückschnitt ein buschiges Wachstum und reichliche „Kätzchen“. Ist sehr gut schnittverträglich und treibt auch aus dem Stock wieder sehr gut heraus.
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Asch-Weide
https://www.naturadb.de/pflanzen/salix-cinerea/
diverse Fachliteratur
Hinweis zu medizinischen Inhalten und Wirkungsweisen:
Die hier vorgestellten Inhalte geben lediglich einen Überblick über die medizinische Nutzung. Sie stellen keine Empfehlung zur Anwendung dar. Bitte suchen Sie daher immer das Gespräch mit einem Arzt oder Apotheker.
Alle Angaben zu Verwendung, Kulinarik oder vermuteter Heilwirkung gelten ohne Gewähr. Die Angaben dazu haben lediglich informativen Charakter und sollen den Leser keinesfalls zur Selbstmedikation anregen, sondern einen Überblick über den momentanen Wissensstand geben.
Eine Haftung hinsichtlich der Verwendung ist ausgeschlossen.